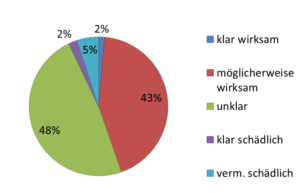Homöopathische Arzneien wirken mindestens so gut wie Antidepressiva und besser als Placebo
Harald Walach
Vorbemerkung und Einführung:
Pharmakologische Antidepressiva – das vorläufige Ergebnis eines Trauerspiels
Peter Gøtzsche, der ehemalige Leiter des Nordischen Cochrane Centers in Kopenhagen und auf Rang 1.849 der 100.000 meistzitierten wissenschaftlichen Autoren, hat die Psychiatrie mit seiner Brandschrift unter Druck gebracht1. Darin hat er argumentiert, die Psychiatrie insgesamt und die von ihr verwendeten Antidepressiva seien wissenschaftlich zweifelhaft, weil ihre positiven Wirkungen die potenziell schädlichen Wirkungen kaum aufwiegen würden, weil viel zu viel davon verordnet werden würden und weil die Studien, auf denen ihre Verordnung basiert, methodisch unsauber seien. Dafür hat er vor Kurzem die Quittung erhalten und ist von seiner Rolle innerhalb der Cochrane Collaboration entbunden worden und hat sogar seine Stelle verloren2. Dieses Beispiel zeigt: in diesem Gebiet sind die kommerziellen Interessen sehr mächtig und es ist nicht ungefährlich, die Mainstream-Meinung herauszufordern.
Das mache ich jetzt trotzdem, weil ich es ärgerlich finde, dass sich die Anti-Homöopathie-Lobby nun eines Grünenparteitags zu bemächtigen sucht, in krasser Unkenntnis der Datenlage. Ich nehme die Depressionstherapie als Beispiel, ein heiß umstrittenes Gebiet.
Angefangen hat der Disput um die Wirksamkeit der Antidepressiva schon in den 90er Jahren, eigentlich schon früher. Es sei daran erinnert: Das erste weit verbreitete Antidepressivum, Fluoxetin, mit dem Handelsnamen Prozac, ist nie als Antidepressivum entwickelt worden, sondern hatte wechselnde Schicksale als Appetitzügler, Schmerzmittel etc., bis es durch eine Bestechungsaktion eines mittlerweile abgesprungenen Pharmamanagers in Schweden auf den Markt kam und so durch die Hintertür auf den amerikanischen und dadurch auf den Weltmarkt3. Irving Kirsch wies als erster darauf hin, dass Antidepressiva nur wenig wirksamer seien als Placebo4. Die Analyse aller, auch der unpublizierten Studien zu den modernen Antidepressiva, den sog. selektiven Serotonin-Reuptake Inhibitoren (SSRIs), zeigte: Ihre Effektgröße ist vergleichsweise klein gegenüber Placebo, nämlich etwa eine Drittel Standardabweichung5 und damit eigentlich niedriger als die halbe Standardabweichung die NICE, die englische Agentur, die für die Bewertung von Gesundheitsmaßnahmen zuständig ist, fordert6. Eine neue Netzwerk-Metaanalyse, ein massives Unterfangen, das alle verfügbaren Studien miteinander in Beziehung setzt, hat nun versucht ein abschließendes Wort zu sprechen7, findet eine generelle Wirksamkeit gegenüber Placebo und immer noch die bescheidene Effektgröße von weniger als einem Drittel Standardabweichung (d = 0.3). Prompt wurde dieser Publikation durch eine Re-Analyse aus der ehemaligen Arbeitsgruppe von Gøtzsche widersprochen, die der Studie handwerkliche Fehler und schlampige Analyse nachweist.8 Die Effekte sind kleiner, bei den unpublzierten Studien sogar winzig, die Verzerrungsmöglichkeit ist groß und die Verlässlichkeit der Befunde geringer als man denkt. Die größte je durchgeführte Studie zu Antidepressiva in der unkontrollierten Praxis, die STAR*D-Studie, zeigt nur geringe Effekte9 und eine Re-Analyse kommt zu dem Schluss, dass auch diese geringen Effekte nur dadurch zustande kommen, dass die Autoren sich nicht an ihr eigenes Protokoll gehalten und ihre Daten aufgehübscht haben10.
Ich referiere diese Geschichte absichtlich etwas ausführlicher um zu signalisieren: selbst in einem anscheinend so klaren Gebiet wie der pharmakologischen Antidepressionstherapie ist die Datenlage sehr verworren, trotz Milliarden von Forschungs- und Entwicklungsgeldern, trotz einem scheinbaren Konsens in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Gesundheitspolitik.
Nun wurden ausgerechnet in diesem Gebiet zwei interessante Homöopathiestudien publiziert: eine Studie von Macias-Cortés und Kollegen aus Mexiko11 und 6 Jahre davor eine Studie von Adler und Kollegen aus Brasilien12.
Homöopathische Therapie der Depression: 2 Beispiele
Macias-Cortés et al. (2015) Individualized Homeopathic Treatment and Fluoxetine for Moderate to Severe Depression in Peri- and Postmenopausal Women11
Die Studie von Macias-Cortés verglich homöopathische individualisierte Therapie, die in den Potenzen C30 oder C200 verabreicht wurde, in einer dreiarmigen Studie mit Fluoxetin (das unter dem Handelsnamen Prozac verbreitet ist) und mit Placebo in einer sog. double-dummy Technik. Das funktioniert so, dass jeder Patient zwei Medikationen erhält, von denen entweder eine oder beide ein Placebo sind, aber jedenfalls beide so aussehen wie das Original. Patienten der Placebo-Gruppe erhalten, verblindet natürlich, zwei Placebos, ein Fluoxetin-Placebo und ein Homöopathie-Placebo. Patienten der Homöopathie-Gruppe erhalten ein homöopathisches Arzneimittel und ein Fluoxetin-Placebo. Patienten der Fluoxetin-Gruppe erhalten ein echtes Fluoxetin und ein Homöopathie-Placebo. Alle Patienten und alle Forscher waren verblindet bezüglich des Inhaltes. Eingeschlossen wurden Frauen mit Depression in der Menopause. Alle 133 Patientinnen erhielten zunächst eine homöopathische Erstanamnese, woraufhin ein homöopathisches Arzneimittel verordnet wurde, das aber nur jenes Drittel der Patientinnen erhielten (insgesamt 44), die in die Homöopathiegruppe randomisiert, also per Zufall zugeteilt, wurden. Da sie zusätzlich das Fluoxetinplacebo erhielten, wussten sie natürlich nicht, dass sie in der Homöopathie-Gruppe waren. Die homöopathische Arznei wurde übrigens aufgelöst in eine Wasser-Alkohol-Lösung zur täglichen Einnahme aufbereitet und hat damit etwas Ähnlichkeit mit der Einnahme von Q- oder 50.000er-Potenzen, die in der Adler-Studie (siehe unten) zur Anwendung kamen. Dadurch nahmen alle Patienten der Homöopathiegruppe täglich entweder ein homöopathisches Arzneimittel oder ein Placebo zu sich. Das Arzneimittel konnte in der Potenz oder im Inhalt angepasst werden, falls sich Symptome verschlimmerten oder neue zeigten. Wer interessiert daran ist, kann in der Zusatztabelle der Online-Publikation die homöopathischen Arzneimittel nachschauen, die verabreicht wurden.
46 Patientinnen erhielten Fluoxetin plus das Homöopathie-Placebo und 43 Patientinnen erhielten zwei Placebos.
Die Studie war offenkundig gut geplant und ausgewertet: Alle Patientinnen, die in die Studie eingeschlossen waren, waren auch in der Auswertung. Das ist das sog. „intention-to-treat“ Prinzip. Dabei wird der robuste Effekt einer Intervention untersucht, weil die Patienten, die herausfallen, normalerweise mit ihren letzten Wert oder dessen Extrapolation in die Auswertung eingehen, was die Analyse konservativ macht. Als Hauptzielkriterium war definiert worden: die Verbesserung auf der Hamilton-Depression-Rating Skala. Das ist eine Fremdeinschätzung, bei der ein Psychiater oder Psychologe Symptome nach einem Interview einstuft. Die einstufende Person muss natürlich verblindet sein, was sie hier war. Oft wird dem Verfahren mangelnde Glaubwürdigkeit attestiert, weil manchmal die Gruppenzugehörigkeit aufgrund von Nebenwirkungen erraten werden kann. Das war in dieser Studie sicher nicht der Fall. Denn die Nebenwirkungen waren auf alle drei Gruppen gleich verteilt und manche „typische“ Nebenwirkungen waren sogar in der Placebo-Gruppe etwas häufiger, wie etwa Verstopfung, Magenprobleme und Erschöpfung. Damit kann also das Hauptzielkriterium als gültig gemessen gelten. Es gab zwei Nebenzielkriterien: die selbstberichtete Verbesserung auf der Beck Depression Skala und die Veränderung der Greene Klimakteriumsbeschwerden-Skala.
Gemessen wurde nach 4 und nach 6 Wochen. Im Hauptzielkriterium war die Homöopathiegruppe signifikant besser als Fluoxetin und besser als Placebo. Der Unterschied der Homöopathiegruppe zu Fluoxetin ist mit einer Effektgröße von d = 0.58 relativ groß und damit auch größer als der durchschnittliche Unterschied von Fluoxetin zu Placebo in den Meta-Analysen. Der Unterschied der Homöopathiegruppe zu Placebo ist ebenfalls signifikant und mit einer Effektgröße von d = 1.5 fast dreimal so groß wie der Unterschied zu Fluoxetin. In dieser Studie ist übrigens auch Fluoxetin mit einer Effektgröße von d = 0.89 Placebo signifikant überlegen. Das Nebenzielkriterium BDI zeigte zwar die gleiche Tendenz, aber die Unterschiede sind klein (d = 0.3 Homöopathie gegenüber Fluoxetin) und nicht signifikant. Der Unterschied in der Greene-Klimakteriumsbeschwerdenskala ist hingegen wieder signifikant, und zwar sowohl Homöopathie gegenüber Fluoxetin als auch gegen Placebo. Eine mehr als 50%ige Besserung in der Hamilton Rating Skala und damit ein deutlicher therapeutischer Effekt zeigte sich bei 54% der Patienten in der Homöopathie-Gruppe, bei 41% in der Fluoxetin-Gruppe und bei knapp 12% in der Placebo-Gruppe, was ebenfalls einen signifikanten Unterschied darstellt. In den Remissionsraten, also der vollständigen Besserung der Depression (definiert als weniger als 7 Punkte auf der 17-Punkte Skala) unterscheiden sich die beiden aktiven Gruppen kaum: 15,9% unter Homöopathie, 15,2% unter Fluoxetin, aber von Placebo, das eine Remissionsrate von 4,7% aufweist.
Die Studie ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert:
- Sie ist dreiarmig und zeigt einen klaren Effekt.
- Sie zeigt, dass individualisierte Homöopathie besser ist als Placebo und Fluoxetin.
- Sie hat klinisch relevante Effektstärken dokumentiert und zwar bei Patientinnen mit mittelschwerer bis schwerer Depression in der Menopause.
- Und das alles, obwohl sie methodisch, soweit ich sehen kann, auf hohem Niveau geplant und durchgeführt wurde und verblindet war.
Die Einschränkungen sollten nicht übersehen werden:
- Die Studie war mit 6 Wochen relativ kurz. Das hat den technischen Vorteil, dass sich eine natürliche Erholung in diesem kurzen Zeitraum nicht so leicht finden lässt, wodurch der klinisch-statistische Unterschied deutlicher wird.
- Die Studie hat mit Frauen, die im Klimakterium depressiv waren eine spezielle Patientinnengruppe untersucht.
- Sie ist trotz der guten Vergleichbarkeit in den Ausgangsparametern relativ klein und monozentrisch.
Dennoch scheint mir dieser Studie im Vergleich mit anderen Antidepressiva-Studien relativ gut zu sein und zeigt einen klaren Effekt individualisierter Homöopathie mit hohen Potenzen (C30 und C200), die in verdünnter Form täglich eingenommen wurden. Das ist ein Befunde, der nicht einfach ignoriert werden kann, solange nicht nachgewiesen wird, dass er durch Betrug oder Selbsttäuschung zustande kam, und das scheint nicht der Fall zu sein.
Adler et al (2009) Homeopathic individualized Q-potencies versus fluoxetine for moderate to severe depression: double-blind, randomized non-inferiority trial12
Die Studie von Adler und Kollegen aus Brasilien ist ein anderes Beispiel. Sie ist eine zwei-armige aktiv-kontrollierte Studie, in der individualisierte Therapie mit Fluoxetin verglichen wurde in einem sog. Non-Inferioritäts-Design. Während die Studie von Macías-Cortés ein Überlegenheitsdesign hatte, also statistisch daraufhin testete, ob Homöopathie besser als Placebo und besser als Fluoxetin ist, waren Adler und Kollegen bescheidener und testeten, ob Homöopathie Fluoxetin nicht unterlegen ist, also ungefähr gleich gut und auf keinen Fall schlechter. Solche aktiv kontrollierten Designs verwendet man häufig dann, wenn es bereits gut eingeführte Standards gibt – wie etwa in der pharmakologischen Depressionsbehandlung – und wenn eine Ethik-Kommission oder die Forscher Patienten nicht unnötigerweise einer Scheinbehandlung durch Placebo aussetzen wollen. Die Planung solcher Designs ist häufig zwei Hintergründen geschuldet: Manchmal fordern es Ethik-Kommissionen ein, manchmal machen Studienplaner das absichtlich, weil es einfacher ist Nicht-Unterlegenheit zu zeigen als Überlegenheit.
In dieser Studie wurden Patienten mit Depression, entweder einfacher oder wiederkehrender Depression, eingeschlossen und erhielten entweder individualisierte homöopathische Therapie mit Q-Potenzen oder Fluoxetin und das jeweils andere Placebo in einer double-dummy Technik, wie oben beschrieben, um die Verblindung aufrecht zu erhalten. Der Erfolg wurde wiederum über eine Rating-Skala durch einen verblindeten Kliniker gemessen, in diesem Falle war es die Montgomery-Asperger Rating Skala. Randomisiert wurden 91 Patienten, 48 in die Homöopathie- und 43 in die Fluoxetin-Gruppe. Beide Gruppen besserten sich deutlich über die 8 Wochen Studiendauer. In die statistische Analyse wurden wiederum alle Patienten eingeschlossen. In der Homöopathiegruppe brachen 19 Patienten die Studie ab, 3 aufgrund von Nebenwirkungen, 5 aufgrund klinischer Verschlimmerung (also kein therapeutischer Effekt), 10 kamen einfach nicht wieder. In der Fluoxetingruppe wurden 8 aufgrund von Verschlimmerungen und einer aufgrund mangelnder klinischer Effekte ausgeschlossen und 8 kamen nicht wieder. Das zeigt: in dieser Studie war offenbar das Monitoring der Patienten weniger sorgfältig und eng, sodass mehr Ausfälle zu verzeichnen sind. Da die Statistik sich aber auf alle Daten stützt und die fehlenden extrapoliert wurden, ist die Analyse zwar robust, weist aber dadurch wohl weniger Sensitivität auf. Die Analyse zeigt: Keine der Gruppen überschreitet die vorher definierte Indifferenzgrenze. Man überlegt bei solchen Designs vorher, was ein minimaler, klinisch relevanter Unterschied ist. Die Nicht-Unterlegenheit ist gezeigt, wenn das Vertrauensintervall des Unterschiedes zwischen den Therapien diesen klinisch-relevanten Unterschied nicht übersteigt. Das tut er nicht, und daher ist in dieser Studie Homöopathie nicht von Fluoxetin zu unterscheiden. Es gibt sogar eine kleine, positive Effektstärke zugunsten von Homöopathie (d = 0.4); aber weil unklar ist, ob die berichteten Daten die Daten aller Patienten sind oder nur die Daten von denen die abgeschlossen haben (was ich vermute), würde ich diesem Unterschied nicht so viel Gewicht beimessen wollen. Bei der statistischen Analyse kann man allerdings Robustheit annehmen, da hier die fehlenden Daten mit den Ausgangswerten interpoliert wurden.
In dieser Studie ist also individualisierte Homöopathie gleich gut wie Fluoxetin, tendenziell etwas besser, aber es war nicht Ziel der Studie, dies zu belegen. Interessant an dieser Studie war die Individualisierung und Behandlung ausschließlich mit Q-Potenzen. Das hat meines Wissens keine andere Studie gemacht. Q-Potenzen sind ja solche, bei denen von der C3 ausgehend alle weiteren Verdünnungsschritte in Schritten 1:50.000 – ungefähr – vorgenommen werden. Von dieser dann als Q1 bezeichneten Potenz wird jeweils weiter potenziert. Von jeder Q-Potenz wird dann wieder ein Kügelchen in Wasser aufgelöst und täglich ein kleiner Schluck genommen. In dieser Studie war das dreimal die Woche der Fall. Man versucht damit einen milden, kontinuierlichen Stimulus zu setzen und Erstverschlimmerungen zu vermeiden. Das scheint einigermaßen funktioniert zu haben. Die Studie war mit 8 Wochen etwas länger als die andere, war ebenfalls doppelt verblindet, allerdings sprechen die größere Zahl von Aussteigern dafür, dass entweder in der Studienlogistik manches nicht so gut funktioniert hat, oder dass überhaupt die Patientenführung nicht optimal war.
Fazit
Zwei Studien zeigen, verblindet und methodisch sauber, dass Homöopathie mindestens gleich gut (Adler), oder sogar besser (Macías-Cortés) als Fluoxetin, ein Standard-SSRI, gegen Depression hilft. Außerdem zeigt eine Studie, dass Homöopathie besser ist als Placebo. Man kann hier natürlich die üblichen Caveats anführen: Das sind erst zwei Studien, in Lateinamerika durchgeführt, die eine ausschließlich bei Frauen in der Menopause, und überhaupt brauchen wir mehr, größere und repräsentativere Studien. Ich weiß gar nicht, ob man sie so viel besser machen kann, als die, die hier vorliegen. Man kann vielleicht für weniger Drop-outs sorgen, länger beobachten, härtere Outcomes verwenden (Komplettremission statt kontinuierlicher Besserung). All das geht und all das sollte man tun. Aber bis diese Forderungen erfüllt sind kann man konstatieren:
Bei Depression ist klassische Homöopathie mindestens genauso gut wie Fluoxetin.
Referenzen:
- Gøtzsche PC. Deadly Psychiatry and Organised Denial. Copenhagen: People’s Press; 2015.
- Gøtzsche PC. Death of a Whistleblower and Cochrane’s Moral Collapse. Copenhagen: People’s Press; 2019.
- Virapen J. Side Effects: Death. College Station, TX: Virtualbookworm; 2010.
- Kirsch I, Sapirstein G. Listening to prozac but hearing placebo: A meta-analysis of antidepressant medication. Prevention & Treatment http://journalsapaorg/prevention 1998; 1: 2a.
- Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R. Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy. New England Journal of Medicine 2008; 358: 252-60.
- Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, Johnson BT. Initial severity and antidepressant benefits: A meta-analysis of data submitted to the food and drug administration. PLoS Medicine 2008; 5(2): e45.
- Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet 2018; 391(10128): 1357-66.
- Munkholm K, Paludan-Müller AS, Boesen K. Considering the methodological limitations in the evidence base of antidepressants for depression: a reanalysis of a network meta-analysis. BMJ Open 2019; 9(6): e024886.
- Trivedi MH, Rush AJ, Wisniewski SR, et al. Evaluation of outcomes with citalopram for depression using measurement-based care in STAR*D: implications for clinical practice. American Journal of Psychiatry 2006; 163(1): 28-40.
- Pigott HE, Leventhal AM, Alter GS, Boren JJ. Efficacy and effectiveness of antidepressants: current status of research. Psychotherapy and Psychosomatics 2010; 79: 267-79.
- Macías-Cortés EdC, Llanes-González L, Aguilar-Faisal L, Asbun-Bojalil J. Individualized Homeopathic Treatment and Fluoxetine for Moderate to Severe Depression in Peri- and Postmenopausal Women (HOMDEP-MENOP Study): A Randomized, Double-Dummy, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. PLOS ONE 2015; 10(3): e0118440.
- Adler UC, Paiva NMP, Cesar AT, et al. Homeopathic individualized Q-potencies versus fluoxetine for moderate to severe depression: double-blind, randomized non-inferiority trial. eCAM 2009; doi:10.1093/ecam/nep114.